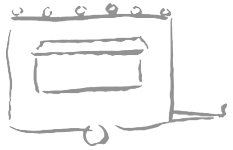Die begehbare Schachtel
Veröffentlicht am 30. April 2023 in der Kategorie Was sonst noch wichtig war
Interview Christian Schiebe / Michael Behn
Die begehbare Schachtel.
Interview mit Christian Schiebe, aufgezeichnet am 21. 10. 2022 in der Galerie Stella A., Berlin

Christian Schiebe: Sie haben als Galerist viele Jahre Erfahrungen als Publikumsbeobachter gesammelt, einem Publikum, das wiederum Papierarbeiten betrachtet …
Michael Behn: Ja, das stimmt. Da lassen sich schwerlich allgemeingültige Aussagen treffen. Die üblichen Kriterien, die in der Kunstwissenschaft gelten – Herkunftsfragen oder technische Fragen – interessieren das Publikum meistens weniger. Das Publikum geht emotional in einem mehr oder weniger geordneten Flickenteppich aus Emotionen, Erinnerungen oder Assoziationen vor. Das ist aber kein Vorwurf. Das mache ich selbst auch oft so. Ich bin ja selbst auch Betrachter und Ausstellungsbesucher noch mehr, als ich selbst auch Künstler bin, also gelegentlich Kunstwerke produziere. Das gilt übrigens für die allermeisten Künstler sowieso. Sie sind in erster Linie Betrachter. Das wird aber meistens ausgeblendet. Dieser ganze Komplex des Betrachtens, der wurde ja ganz lange in der Bildwissenschaft vernachlässigt. Erst in den letzten dreißig Jahren ist das wieder ins Blickfeld gerückt.
CS: Sie leiten Ihren Text zum „Rezeptiven Akt“ unter anderem mit Duchamp ein, der die Theorie aufstellte, dass erst ein Publikum durch das Betrachten ein Kunstwerk vervollständigt.
MB: Duchamp ist ja noch radikaler, er sagt, der Betrachter erschafft das Werk überhaupt erst. Ohne den geht’s gar nicht. Der Künstler kann noch so sehr von allen Dächern schreien, dass er ein Genie sei – sofern nicht irgendeiner sagt: Stimmt! – nützt das gar nichts. Und dann kommt es noch darauf an, wer das nun bestätigt. Das ist die „Zeitenwende“. Das war damals Duchamps wichtigste Aussage, dass der Betrachter die maßgebliche Person ist.
CS: Und würden Sie dem zustimmen?
MB: Ich muss es erst einmal zur Kenntnis nehmen. Und würde dem – ja – weitgehend zustimmen. Man hat so eine gewisse Scheu. Auch wenn man als Künstler manchmal tätig ist oder gewesen ist, dass man diese Rolle so ganz von sich weg geben will. Aber es funktioniert ja gar nicht anders. Dieser Kampf um Aufmerksamkeit, der uns umgibt. Aus irgendwelchen Gründen kostet ein Bild dann plötzlich 50.000.- € und aufwärts und ein anderes Werk, das kaum zu unterscheiden ist, gar nichts…
Das bewirken allein die Betrachter.
CS: Was mich an dieser Theorie erstaunt, ist das Verhältnis des autonomen Kunstwerks dazu. Das beschreiben Sie in ihrem Text auch. Bereits Denis Diderot hat gefordert, dass das Werk nicht für das Publikum geschaffen werden soll. Man solle möglichst nicht an das Publikum denken, man spiele, als ob der Vorhang nicht aufgezogen würde.
MB: Diese Haltung hat Diderot ja ganz gut beschrieben und das war ja lange Zeit auch sehr en vogue in der Bildenden Kunst. Alles, was auch nur annähernd den Anschein erweckte, dass es dem Publikum gefallen würde oder könnte, stand immer im Verdacht, sich dem Publikumsgeschmack anzupassen und entsprach nicht dem Ideal der Kunst. Das Interessante daran ist, dass Kunstwerke nicht nur durch ihre Anerkennung leben können, sondern auch durch ihre Ablehnung. Kunstwerke wirken sogar durch ihre Ablehnung oftmals viel stärker in die Kunstgeschichte hinein. Die berühmten Skandale um Guernica und nicht zuletzt auch um Duchamp… Diese Werke sind nicht von Anfang an auf Zustimmung gestoßen – zunächst auf Ablehnung, manchmal bis hin zum Skandal… Das haben wir alles heute auch noch, diese sogenannte Schockwirkung. Es hat sich nur alles nivelliert und ist komplizierter und vielschichtiger geworden.
CS: Kunstwerke sind also auf die Mitarbeit des Publikums angewiesen. Bei dem einem mehr oder bei dem anderen weniger. Aber man könnte jetzt nicht sagen, dass die Bildende Kunst das Publikum dort abholt, wo es gerade steht.
MB: (lacht) Das versuchen die manchmal aber auch…
Museen versuchen das vor allem sehr.
CS: Über ein pädagogisches Konzept.
MB: Wenn man früher kaum an das Publikum gedacht hat, dann hat es sich diesbezüglich vollkommen geändert. Heute wird fast nur noch an das Publikum gedacht. Es geht um Besucherzahlen oder wie beim Fernsehen um Einschaltquoten, Anzeigenkunden und so weiter. Es geht um Geld. Das hat sich in den letzten Jahren drastisch geändert. Jede Ausstellung, die geplant wird, wird von vornherein unter dem Gesichtspunkt: „Kriegen wir damit auch genug Leute ran?“, geplant. Ist es irgendwie sensationell? Und so weiter…
CS: Bei Fluxus gab es die Idee, Kunst für alle zu machen. Es ging aber vor allem die Kennergemeinde zu Happenings, Environments oder den Konzerten, nicht die Person aus dem Supermarkt hinter der Kasse, keine Verkehrspolizisten… lediglich ein Feuerwehrmann – aber der musste ja aus gesetzlichen Gründen dort wachen.
Sie beschrieben diese Anekdote, bei der Sie den besagten Feuerwehrmann beobachteten, der sichtlich seinen Spaß hatte.
MB: Ja, in dieser Schilderung war das ein absoluter Glücksfall. Da hatte man das Gefühl, da ist das auf die richtigen Ohren gestoßen – oder auf die Augen, an die man damals mehr dachte. Ist aber ganz selten passiert. Andererseits war der Feuerwehrmann auch sehr aufgeregt, weil damals noch alle rauchten, besonders hinter der Bühne …
Die Fluxus-Leute haben das anders gemacht als ihre Vorgänger, die sogenannten Abstrakten Expressionisten – die für das Publikum im Grunde unverständlich waren. Dagegen hat sich Fluxus schon mal sehr gewandt. Es ging darum, die tatsächlichen Lebensbereiche des Publikums zu berühren. Die Trennung zwischen Kunst und Leben nicht so groß zu machen. Bis hin zur völligen Übereinstimmung. Überhaupt nicht meine Idee, aber so wurde das teilweise formuliert. Wolf Vostell: „Kunst ist Leben und Leben ist Kunst…“
CS: Dann das berühmte „Jeder Mensch ein Künstler“…
MB: Beuys. Ja, sein berühmtestes Zitat, das ja nun auch zu permanenten Missverständnissen führte. Und immer noch durch die Welt geistert. Sicher kommt das auch aus der Zeit und das hat man ihm ja auch sehr übel genommen. Eigentlich kann ich nur sagen, ich bin froh, dass das vorbei ist.
Aber das musste gemacht werden, damals. Man muss sich ja mal vergegenwärtigen, dass diese abstrakte Malerei, die damals aus Amerika rüberschwappte, von Barnett Newman und anderen, das Publikum einfach ratlos daneben stehen ließ. Keinerlei Zugang zu deren Problemen damals – ob das die Miete war oder der ganze normale Kram, das war völlig ausgeblendet. Das tauchte aber bei Fluxus wieder auf. Weil Fluxus ja auch sehr viel mit Humor gearbeitet hat. George Maciunas, als Chef-Gründer hatte ja die Idee, dass Fluxus eine Mischung aus Kabarett und Unterhaltungstheater, also viel Humor haben sollte. Wenn Sie Komiker sind, dann müssen Sie an das Publikum denken. Sonst hat es überhaupt keinen Zweck! Da muss immer eine Interaktion sein.
CS: Wie war das mit der Interaktion? Würden Sie sagen, dass das gut funktioniert hat?
MB: Es hat funktioniert. Nicht immer so, wie es sich die Autoren gedacht haben. Es war oft feindliche Ablehnung, Unruhe, manchmal auch Sympathie oder Amüsement, sicher auch, aber überwiegend war Ablehnung, teilweise auch sehr aggressive Ablehnung. Bis hin zu Rangeleien, blutige Nase für Beuys in Aachen, sowas.
Ich war bei einigen Veranstaltungen, die René Block veranstaltet hat, als Aufführender dabei. Das Wort Performer gab es damals im Deutschen noch gar nicht. Viele Kompositionen von Fluxus-Künstlern waren ja so ausgelegt, dass man Aufführende brauchte. Erst einmal hatte man gar keine ausgebildeten Musiker zur Verfügung, für die war das nicht Kunst genug und insofern mussten da Laien ran. Ich hatte eine ganz gute Voraussetzung, weil ich sehr ruhig war und nicht so leicht zu verunsichern. Das hat mir dann verschiedene Auftritte eingebracht. Aber vielleicht auch, weil kein anderer da war, ich weiß es nicht.
Natürlich war im Publikum damals schnell Unruhe, wenn nichts passierte. Dann werden die Leute unruhig, Zwischenrufe und Gelächter und Rauslaufen – das ganze Programm. Aber manchmal gab es auch Zeiten von großer Konzentration! Das erinnere ich auch. Wenn das zu halten war, das waren die erfolgreichsten Momente.
Ein Musterbeispiel ist Tomas Schmit, mit seiner berühmten Aufführung „Zyklus“. Da wurde das Publikum gebeten, Joghurtflaschen mitzubringen, und dann hatte er eben zwanzig solcher Flaschen um sich herum aufgestellt und eine Flasche war gefüllt mit Wasser, und er hat das Wasser dann immer von einer Flasche zur anderen geschüttet. Bis alles verschüttet war oder verdunstet … Und das dauert.
Tomas Schmit hatte eine sehr gute Konzentrationsfähigkeit und die Leute blieben bei der Stange. Die Aufmerksamkeit blieb dabei. Das muss man wirklich sehr anerkennen und das fand in einer Galerie statt, das war kein Theater – nur ein kleiner Galerieraum. Auf jeden Fall war das eine Aktion, wenn man als Zuschauer begriffen hatte, um was es da geht – schütten – das hätte ja jeder auch selbst machen können. Das war nicht mehr so rätselhaft, wie es zu der Zeit sonst mit der Kunst war. Das ist der entscheidende Unterschied gewesen. Jeder konnte sehen: Aha – da gibt es ein bestimmtes Konzept. Der schüttet das immer weiter und weiter und weiter. Mal schauen, wie lange das dauert. Da war Tomas Schmit sehr beispielhaft, wenn es darum ging, die Fluxus-Idee auf ihre Essenz zu reduzieren.
Es gab auch ganz gegenteilige Fluxus-Aufführungen mit sehr opulentem Materialverschleiß. Vostell zum Beispiel, auf einem Autofriedhof. Der Schmit war mir da immer sehr sympathisch, weil er eben die Sache sehr reduziert hat. Wie auch in seinen Zeichnungen. Man braucht nicht viel, um eine Idee zu transportieren. Eigentlich braucht man fast gar nichts.
CS: Das würde ich gerne aufgreifen, um auch über Stella A. zu sprechen. Wenn ich sagen müsste, was das Konzept Ihrer Galerie im wesentlichen ausmacht, würde ich behaupten: Wenn es mit dem Kleinen funktioniert, dann sollte es bei dem Kleinen bleiben.
MB: Ja, auf jeden Fall. Alle Kunst, die mit zu viel Aufwand betrieben und mit zu viel Material und Geld hergestellt wird, ist mir suspekt. Ich weiß nicht, ob es in jedem Fall immer so zutrifft, aber im großen und ganzen hat es sich für mich herausgeschält, dass mir das näher ist. Ich bin schon skeptisch, wenn Künstler riesige Ateliers haben. Und das stimmt schon sehr mit den Fluxus-Ideen überein.
CS: Dann enthielt Fluxus vor diesem Hintergrund eine radikale Erweiterung des Kunstbegriffs.
MB: Hab ich so verstanden und das kann man historisch bestimmt auch so sagen. Das war wohl die radikalste Bewegung der 60er-Jahre. Es gab noch diverse andere Gruppierungen zu der Zeit, aber die schienen mir alle zu sehr in ihren eigenen Mauern eingesperrt. Bei Fluxus wusste eigentlich keiner genau, was das ist. Es wurde immer mal wieder versucht, es zu definieren. Aber kaum hatte das einer formuliert, schon war der Nächste da und sagte: Völliger Quatsch! Das machen wir gar nicht! George Maciunas versuchte am meisten zu bestimmen, wer oder was Fluxus ist. Gelegentlich wurden Künstler von ihm ausgeschlossen oder wieder aufgenommen. Niemand wusste genau, wer gerade exkommuniziert war und wer nicht. So war das ja auch mit den Zeiten: Tomas Schmit sagte ja, Fluxus ging nur so 5 Jahre. Andere sagen, Fluxus gab es immer schon und gibt es vor allem auch heute noch. Da gibt es ganz unterschiedliche Positionen.
CS: In Ihrem Text erwähnen Sie auch das „unkonditionierte Sehen“. Und dass es das im Grunde nicht geben kann, weil es dann ein Nicht-Sehen wäre. Aber gleichzeitig ist das, bei einem autonomen Kunstbegriff, eigentlich der größte Wunsch: Auf ein Werk zugehen zu können und es so noch nie zuvor gesehen zu haben.
MB: Darauf kann ich auch keine endgültige Antwort geben. An Heideggers berühmter Abhandlung „Der Ursprung des Kunstwerkes“ habe ich mich damals sehr aufgerieben. Zusammengefasst benutzt er darin das Kunstwerk, um damit seine Auffassung vom Sein zu evozieren. Und er sagt ja eigentlich, man sollte nicht den Fehler machen, „zu glauben, dass wir da alles nur hineinlegten“. Während ich darauf hinweisen möchte, dass fast immer das Gegenteil der Fall ist. Wir tun fast alles da hinein. Ich will es nicht abschließend beurteilen. Ich bin da vorsichtig und denke, dass sich die Menschen eher der Konditionierung bewusst werden, die Bedingungen, die Beschränkungen sehen können. Das ist schon mal viel wert. Sich bei jedem Gedanken beobachten können und zu sehen: Das ist ein Gedanke, der taucht jetzt auf, das ist aber nicht mein Ich. Das ist nicht die Essenz. Der läuft durch mich durch. Der hat seine Ursache usw… Sich dessen bewusst zu werden und das zu beobachten, das ist eigentlich auch die buddhistische Meditationspraxis. Wenn wir jetzt auf Heidegger zurückkommen, da spielt der Betrachter noch keine Rolle. Heidegger bildet ein Dreieck aus Künstler und Werk und dem Kunstbegriff. Aber die Idee des unkonditionierten Sehens finde ich durchaus Interessant. Aber man kann sie sicher nicht leichtfertig verwenden: Die neuen Sichtweisen etc …
CS: Wann haben Sie begonnen, Kunst zu sammeln und womit?
MB: Bei René Block lernte ich einige Künstler kennen, unter anderem Gerhard Richter und vor allem Beuys, K.P. Bremer, Ludwig Gosewitz und noch ein paar Leute. Und dann habe ich gedacht: Ja, so einen Richter… Ich fand das schon interessant – als Bild. Also, ich kaufe das mal. Das kann man vielleicht irgendwann mal ganz gut wieder verkaufen. Dass diese Sachen dann solche Preissprünge machen würden, damit hat niemand gerechnet. Ein bisschen Geld hatte ich auch, weil ich damals ja noch als Lithograph gearbeitet und ganz gut verdient habe und die Miete damals 50.- Mark kostete, oder so. Dann hab ich ein großes Staubbild von Beuys gekauft. Nicht so spekulativ, mehr um es – wenn auch im kleinen WG-Zimmer – an die Wand zu hängen. Denn das gibt dann noch mal ein ganz anderes Verhältnis zu so einer Arbeit, als wenn man es sich in der Galerie anguckt. Dann ist das ein Teil des eigenen Lebens. Plötzlich muss man sich ganz anders dazu verhalten. Bei Beuys war es besonders gravierend, weil das überhaupt keiner verstanden hat – ich auch nicht. Das war in seiner Fremdartigkeit so faszinierend, dass ich schon dachte: Da passiert wirklich was Neues. Und Beuys hat auch immer geschaut, wer das eigentlich haben will. Und wenn der gesehen hat, das sind zum Beispiel Studenten, dann hat der manches Zeug auch fast verschenkt! Ähnlich war es bei Richter damals auch. Vorher hatte ich immer gedacht, Kunst kaufen ist nur was für Reiche. Das man das auch selber machen kann, dass war mir gar nicht bewusst.
CS: Könnte man also sagen, dass die Fluxus-Bewegung in gewissem Maße auch auf das Publikum einging, weil es eben erschwingliche Kunst war?
MB: Ja, auf jeden Fall. Der große sogenannte Demokratisierungsversuch der Kunst. Die Fluxus-Schachteln, von denen einige heute selten und gesucht sind, lagen jahrzehntelang in den Regalen, kein Mensch wollte sie haben, obwohl sie sehr preiswert waren. Man kann mit den Sachen auch nicht so gut angeben. Die geben nicht so viel her. Erfolgreich war dann Pop Art. Die haben die alltäglichen Gegenstände, die ja auch bei Fluxus Thema waren, schön auf Leinwand gebracht und das hat dann die hohen Preise erzielt. Wobei die ersten Siebdrucke auch noch erschwinglich waren. Bei Springer für 60.- DM. Siebdruck war damals in der Kunst noch fast unbekannt. Radierungen, Lithographien, ja. Aber Siebdruck war etwas anrüchig, so mechanisch, hohe Auflage, günstiger Preis. Im Grunde war mein erster Kauf ein Plakat (Rauschenberg). Das hat eine ganze Weile in meinem Zimmer gehangen und ich dachte: Das sieht ziemlich cool aus. Damit konnte man schon ein bisschen was her machen. Da gab es was zu sehen. Fluxus war viel weniger dekorativ.
CS: Und Fluxus und die Zeichnung?
MB: Es wurde viel Fluxus-Kunst auf Papier gemacht. Nicht unbedingt im klassischen Sinne der Zeichnung. Aber einfach als Form des sehr preiswerten Materials. Das waren eben Papierarbeiten. Vorher gab es so etwas auch noch nicht. Die Zeichnung gab es immer schon. Oder es gab die klassische Druckgrafik auf Papier, aber alles, was dazwischen liegt: Postkarten, Flugblätter, Einladungskarten, Notizzettel, Hinweisschilder – was normalerweise im Kunstbereich nicht beachtet wurde – das haben die Fluxus-Künstler mit in die Kunstwelt hineingebracht und dadurch gab es ein großes Feld von Papierarbeiten. Stanley Brouwn ließ Wegbeschreibungen zeichnen… Das war alles sehr interessant.
Irgendwann hatte ich selbst in kleinen Auflagen Zeug zusammengebastelt und bin mit denen zu Buchhandlungen und zwei, drei Galerien (König, Hundertmark oder Barbara Wien) gegangen. Es gab so ein paar Anlaufpunkte und manches haben die auch genommen. Das hat mir dann ein bisschen Mut gemacht. Es gab also vielleicht doch ein paar Leute, die das gebrauchen konnten und ich kannte auch ein paar Leute, die Ähnliches machten, und da dachte ich, dass ich schon gerne irgendwann meinen eigenen Laden haben würde. Ich hatte keine Lust mehr, Klinken zu putzen, dann lieber einen öffentlichen Raum (sei er noch so klein) selbst zu machen. Und dann hat sich das hier so entwickelt. Damals war hier in Mitte das Zentrum des Kunstgeschehens und da musste man auch hier sein.
CS: Wann haben Sie die Galerie Stella A. eröffnet?
MB: Das war im Herbst 99. Dann kam die Ernüchterung. Die Realität wurde uns klar. Ich dachte, wir machen Editionen, Schachteln und so etwas. Aber wir haben schnell gemerkt, davon kann man nicht mal sein Bier bezahlen. Wir mussten also doch ein bisschen in den konventionelleren Kunstbetrieb und richtige Ausstellungen machen, mit Künstlern, Werken, Ausstellungseröffnungen usw. Ab und an mussten wir einfach was verkaufen… Meistens haben wir eher nichts verdient. Hin und wieder mal. Und das ging auch alles nur zusammen mit Dorle Döpping, die mich sehr unterstützt hat. Das hätte ich mich alleine gar nicht getraut.
CS: Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, einerseits die Kunst nicht als Ware zu betrachten, nicht als Dekorationsobjekt, sondern als Teil des Lebens und dann auch einen Raum dafür zu schaffen, in dem die Dinge dann zu sehen sind, die sonst womöglich auch eher übersehen werden und dann aber doch in die wirtschaftliche Verknüpfung kommen müssen – zwangsläufig. Eine Galerie kostet Miete, Nebenkosten usw. Ich frage mich immer, wie sich das überhaupt vertragen kann.
MB: Es gab ja bei Fluxus diese Schachteln und wir dachten, man muss die Schachtel einfach nur vergrößern. Der Laden Stella A. ist gewissermaßen eine begehbare Schachtel, in der intelligente Dinge platziert sind und zur Diskussion gestellt und auch gekauft werden können. Und mit entsprechender Verzögerung kam es ja dann auch tatsächlich zu Verkäufen. Das ist dann auch passiert. Vieles, was Sie jetzt hier sehen, habe ich selbst irgendwann gekauft und damals gedacht, dass das eigentlich unterschätzt wird. Damals dachte ich, dass ich das retten müsste.
CS: Haben Sie das heute noch? Dass Sie schauen; was muss ich retten?
MB: Manchmal schon, kaufe ich noch heimlich einen Katalog oder Ähnliches, besonders wenn ich das Gefühl habe, es ist unterbewertet. Ich muss mich da zusammenreißen. Nur noch, wenn es gar nicht anders geht.
CS: Wie würden Sie rückblickend ihr Verhältnis zum Publikum beschreiben?
MB: Über ein ganzes Publikum kann ich gar nichts sagen. Es gibt einzelne Menschen hier, das sind natürlich viele Künstler, mit denen ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Also überwiegend. Und auch einzelne Kunden. Man braucht gar nicht so viele. Ich hatte eigentlich nur ein, zwei Sammler. Und die haben für relativ viel Geld gekauft. Aber für das große Publikum bin ich nicht so begabt. Große Menschenmengen machen mir eher keine so guten Gefühle. Es sind meistens Gespräche zu zweit oder zu dritt. Die funktionieren für mich. Oft genug war es auch so, dass hier zwanzig, dreißig Leute waren – aber das ist dann der übliche Smalltalk und da bin ich gar nicht gut drin.
CS: Sie haben einmal gesagt, was Sie hier eigentlich machen, ist Kammermusik.
MB: Ja, im klassischen Sinne: Für kleine Ensembles. Es ist ja eigentlich, in dieser Welt, ein idealistisches Unterfangen. Und das wird ja auch oft genug belächelt. Aber das war mir auch immer klar: Wir müssen Idealisten sein. „We must become idealists or die“ sagte Gustav Metzger.
Berlin, März 2023